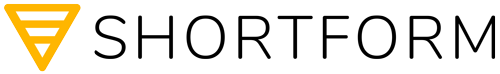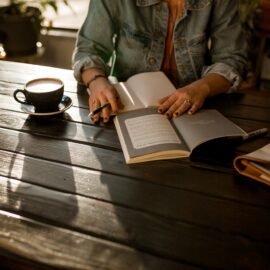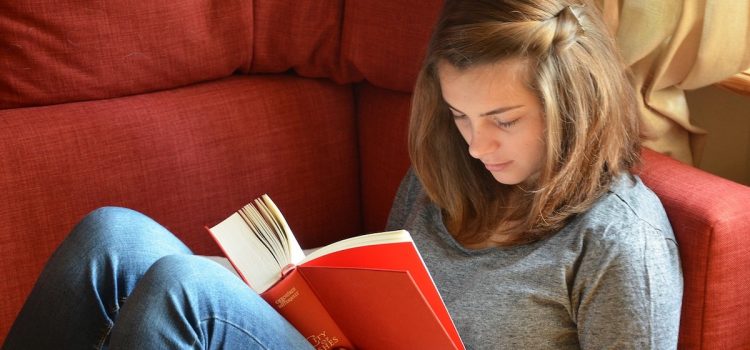
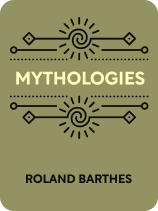
Dieser Artikel ist ein Auszug aus dem Shortform Buchführer zu "Mythologien" von Roland Barthes. Shortform hat die weltweit besten Zusammenfassungen und Analysen von Büchern, die Sie lesen sollten.
Gefällt Ihnen dieser Artikel? Melden Sie sich hier für eine kostenlose Testversion an.
Steckt in dem Meme, das Sie gerade in den sozialen Medien geliked haben, eine versteckte Botschaft? Ist der Mythos im Wesentlichen Propaganda?
Nach Roland Barthes entstehen Mythen, wenn die herrschenden Institutionen der Gesellschaft einem Bild, einem Objekt oder einem Satz eine Bedeutung verleihen. Durch die Bildung dieser Assoziationen schaffen und verstärken die herrschenden sozialen Institutionen kulturelle Überzeugungen und Werte, die von den Massen unbewusst übernommen werden.
In Mythologien will Barthes uns die Augen für diese Manipulationen öffnen und uns lehren, wie wir sie vermeiden können. Hier ist ein Überblick über das Buch.
Überblick über die Mythologien von Barthes
In Mythologien macht Barthes auf die Mythen aufmerksam, die uns ständig umgeben. Denken Sie an all die Bilder, Botschaften und Geschichten, mit denen Sie im Laufe des Tages konfrontiert werden. Wenn Sie morgens die Zeitung aufschlagen, sehen Sie Fotos von Kriegen, Profile von politischen Kandidaten und Unternehmern und Berichte über die neuesten Aktienkurse. Wenn Sie durch die sozialen Medien blättern, werden Sie mit einer Flut von Fotos, Videos, Anzeigen und Memes konfrontiert, die alle eine bestimmte Botschaft vermitteln. Gehen Sie in ein Geschäft, und die Produkte werden Ihre Aufmerksamkeit erregen - bewusst und unbewusst - mit Designs und Slogans.
Laut Roland Barthes, einem einflussreichen französischen Philosophen und Literaturkritiker des 20. Jahrhunderts, sind diese Objekte und Bilder, die wir täglich konsumieren, mit Mythen gefüllt. Er sagt, dass der Mythos eine Art der Kommunikation ist - ein Mythos vermittelt eine Botschaft. Mythen entstehen, wenn die herrschenden Institutionen der Gesellschaft (z. B. die Regierung, die Werbeindustrie oder Hollywood) einem Bild, einem Objekt oder einem Satz eine Bedeutung verleihen. Diese Bedeutungen dienen dann dazu, die Art und Weise zu formen, wie die Menschen in der Gesellschaft die Welt sehen. Indem sie diese Assoziationen hervorrufen, schaffen und verstärken diese dominanten sozialen Institutionen im Wesentlichen kulturelle Überzeugungen und Werte, die von den Massen unbewusst übernommen werden.
In Mythologien (ursprünglich 1957 veröffentlicht) analysiert Barthes eine Reihe solcher Mythen aus dem Frankreich der 1950er Jahre. Teil 1 des Buches ist eine Reihe von Essays aus einer monatlichen Kolumne, die er zwischen 1954 und 1956 für die Literaturzeitschrift Lettres Nouvelles schrieb. Jeder Aufsatz behandelt einen Mythos aus der französischen Gesellschaft, untersucht die Nuancen, die sich dahinter verbergen, und erklärt, wie er bestimmte Werte vermittelt. In Teil 2 führt Barthes eine eher theoretische Diskussion über den Mythos.
Wir werden Barthes' theoretischen Rahmen für den Mythos erörtern und einige der von ihm angeführten Beispiele aus der französischen Kultur der 1950er Jahre untersuchen.
Shortform Hinweis: Der Inhalt dieses Buches ist stark vom sozialen und politischen Kontext der Zeit und des Ortes geprägt, an dem es geschrieben wurde, und ist auch ein Produkt von Barthes' politischen Neigungen. Frankreich hatte in den 1950er Jahren gerade den Zweiten Weltkrieg hinter sich gelassen und befand sich in einer Zeit des raschen sozialen Wandels. Die Mittelschicht war auf dem Vormarsch, und konservative politische Kräfte vertraten eine anti-intellektuelle, populistische und einwanderungsfeindliche Agenda, um an dem festzuhalten, was sie als "traditionelle" Werte propagierten. Barthes war fortschrittlich und marxistisch und setzte sich dafür ein, die Propaganda, die er um sich herum sah, anzuprangern und das Bewusstsein dafür zu schärfen).
Teil 1: Das Verständnis des Mythos
Bevor wir erörtern, wo der Mythos in der Gesellschaft auftaucht, sollten wir zunächst den Mythos definieren, wie Barthes ihn darstellt. Barthes erklärt, dass ein Mythos eine Botschaft ist, die vermittelt wird, wenn ein Objekt, ein Bild oder ein Satz mit einem Konzept oder einem Wert assoziiert wird und somit eine symbolische Bedeutung erhält. Mythen formen die Art und Weise, wie wir die Welt sehen, und üben Macht über uns aus, wenn die herrschenden Institutionen der Gesellschaft diese Botschaften für uns entwerfen.
Die Bestandteile des Mythos: Form und Konzept
Barthes argumentiert, dass Mythen zwei grundlegende, miteinander verknüpfte Komponenten haben: eine Form und ein Konzept. Die Form eines Mythos ist konkret: Es ist das tatsächliche Objekt, das Bild oder der Satz, den wir mit unseren Sinnen wahrnehmen. Barthes erklärt, dass diese Materialien für sich genommen eine wörtliche Bedeutung haben. Die Kraft des Mythos besteht jedoch darin, dass er diesen Dingen eine zusätzliche Bedeutung verleiht. Der Mythos entsteht, wenn die Gesellschaft das Rohmaterial der Form mit einem abstrakten Konzept verbindet.
Barthes weist auch darauf hin, dass der Mythos dem Rohmaterial nicht nur eine neue Bedeutung hinzufügt, sondern auch die ursprüngliche Bedeutung verzerrt . Die ursprünglichen Bedeutungen verschwinden zwar nicht völlig, aber sie treten in die sekundäre Rolle der Unterstützung des Mythos zurück. Nach Barthes ist dieses Zurücktreten der Bedeutung der Form wichtig, weil es den Mythos vollkommen natürlich erscheinen lässt. Mit anderen Worten, es verbirgt die Tatsache, dass die Beziehung zwischen der Form und dem Konzept eine Konstruktion ist.
Die Entstehung und Funktion des Mythos
Nachdem wir nun verstanden haben, was Barthes unter Mythos versteht, wollen wir uns nun der Frage zuwenden, wie Mythen in der Gesellschaft geschaffen und genutzt werden. Nach Barthes ist der Mythos im Wesentlichen ein Mittel zur Schaffung von Kultur. Genauer gesagt argumentiert er, dass es sich um die Schaffung einer "idealen Kultur" handelt, die die Realität und die Vielfalt verschleiert. Obwohl Barthes das Wort nicht verwendet, behauptet er im Wesentlichen, dass Mythen Propaganda sind.
Er geht davon aus, dass Institutionen in der Gesellschaft Assoziationen zwischen bestimmten Zeichen und Begriffen schaffen, die von der Bevölkerung verinnerlicht und als natürlich angesehen werden.
Barthes will insbesondere die Klassenkonstruktionen kritisieren, die dem Mythos in seiner eigenen Kultur (Frankreich der 1950er Jahre) zugrunde liegen. Er sagt, der Mythos sei wie eine Maske, die eine Unwahrheit präsentiert und die Menschen vor der harten Realität schützt, die dazu dient, die soziale Ordnung aufrechtzuerhalten und die Klassenunterschiede zu verstärken.
Die Gefahren des Mythos
Barthes meint, ein entscheidendes Merkmal des Mythos sei seine Fähigkeit, als "natürlich" zu erscheinen, obwohl er konstruiert ist. Das bedeutet, dass die Menschen den Mythos nicht in Frage stellen und ihn stattdessen als Tatsache akzeptieren.
Barthes argumentiert, dass der Mythos sowohl notwendig als auch problematisch ist. Er ist bis zu einem gewissen Grad notwendig, sagt er, weil er den Menschen eine vereinfachte und bequeme Welt angesichts der harten Realitäten schafft.
Barthes weist darauf hin, dass wir uns auf ein gefährliches Terrain begeben, wenn der Mythos den "Schmutz" ernsterer Probleme wie Rassismus, Sexismus oder Faschismus verschleiert, denn dann können die Menschen dazu kommen, diese als natürlich und normal zu akzeptieren und sie nicht zu hinterfragen.
Barthes sagt, dass der Mythos das perfekte Vehikel für die Förderung politischer Agenden ist. Dies hat die gefährliche Implikation, dass Menschen manipuliert werden können, um soziale und politische Agenden zu unterstützen, die ihren eigenen Interessen oder Werten zuwiderlaufen und unterdrückerische soziale Strukturen aufrechterhalten.
Teil 2: Die Mythen, die die soziale Wirklichkeit schaffen
Nachdem wir nun verstanden haben, was Mythen sind und wie sie entstehen, wollen wir uns konkrete Beispiele dafür ansehen, wie Mythen zur Festigung kultureller Normen und Werte eingesetzt werden. Da Mythologies 53 Essays enthält, die Beispiele für Mythen beschreiben, die Barthes in französischen Zeitschriften gesammelt hat, haben wir die häufigsten Themen unter ihnen identifiziert - nämlich Klasse, Ethnie, Geschlecht und Schönheitskonstruktionen - und eines von Barthes' Beispielen ausgewählt, um jedes Thema zu illustrieren. Anschließend werden wir dieselben Konzepte anhand zeitgenössischer Beispiele veranschaulichen.
Klassenkonstrukte: "Die Blaublut-Kreuzfahrt"
Barthes beschreibt einen Nachrichtenbeitrag über Mitglieder des europäischen Königshauses, die 1954 auf einer Yacht zu den griechischen Inseln segelten. Er kritisiert die Medienberichterstattung über dieses Ereignis, in der es unter anderem darum ging, was sie anhatten und wann sie aufgewacht sind.
Barthes sagt, der Mythos liege in der Darstellung von Königen, die vorgeben, normale Menschen zu sein. Aber die tiefere Botschaft, die dieses Spektakel vermittelt, ist, dass sie per Definition keine normalen Menschen sind. Warum sollten die berichteten Details sonst Nachrichtenwert haben?
Diese Art von Mythos, so Barthes, schafft und verstärkt Vorstellungen von Klassenunterschieden und vergöttert den Adel, indem er ihn als mehr als menschlich darstellt.
Geschlechterkonstruktionen: "Romane und Kinder"
In seinem Essay "Romane und Kinder" untersucht Barthes die Mythen der Ungleichheit zwischen den Geschlechtern, indem er einen Artikel der Zeitschrift Elle über Schriftstellerinnen beschreibt. In dem Artikel wird eine Reihe von Schriftstellerinnen vorgestellt. e weist darauf hin, dass in dem Artikel die Rolle der Frauen als Ehefrauen und Mütter ebenso viel Zeit in Anspruch nimmt wie ihre Karriere.
Barthes sagt, dass dieser Artikel die Botschaft vermittelt, dass Frauen sich nur dann einer Karriere hingeben dürfen, wenn sie auch ihre Hauptaufgabe erfüllt und Kinder bekommen haben. Barthes weist auch darauf hin, dass die Zielgruppe dieses Mythos nicht nur Frauen, sondern auch Männer sind. Er argumentiert, dass dieser Mythos dazu dient, eine patriarchalische Struktur in der Gesellschaft zu verstärken und aufrechtzuerhalten, was am effektivsten geschieht, wenn Männer und Frauen sich darauf einlassen.
Rassische Konstrukte: "Der Bichon unter den Schwarzen"
In seinem Essay "Bichon unter den Schwarzen" beschreibt Barthes eine Geschichte aus der französischen Zeitschrift Match über ein weißes Paar, das mit seinem kleinen Sohn Bichon Afrika besucht. In dem Artikel, so Barthes, werde der "Mut" der Familie stark betont. Der hier dargestellte Mythos ist eine Erzählung über Ethnie, in der das weiße Paar als heldenhaft dargestellt wird, weil es bereit war, sich unter die "wilden" Afrikaner zu begeben.
Barthes behauptet, dass der ungebildete Leser eines Artikels wie "Bichon Among the Blacks" nicht in der Lage wäre, die Bedeutung - eine subtile Botschaft der weißen Vorherrschaft - bewusst zu erkennen, aber dass sie dennoch seine Wahrnehmung der Welt beeinflussen würde.
Schönheitskonstrukte: "Das Gesicht der Garbo"
Hier analysiert Barthes die Darstellung des Gesichts der Schauspielerin Greta Garbo in Filmen und Fotos. Er verweist auf Beleuchtungs-, Schmink- und Schnitttechniken, die ihr Gesicht perfekt erscheinen lassen sollen, ohne jemals einen Makel oder eine Falte zu zeigen. Ihr Gesicht stehe für ein kulturelles Ideal von Schönheit, Reinheit und Jugend, das unerreichbar und zugleich unvergesslich sei.
Barthes bezeichnet das Gesicht von Garbo als "eine Idee", da es eine Botschaft über das vermittelt, was er "amour courtois" nennt - das Konzept einer edlen und ritterlichen Art von Liebe. Die Bevölkerung soll sie als eine Art göttliches Wesen wahrnehmen, das eine Schönheit besitzt, die sie anstreben sollte, aber nie erreichen kann.
Auch hier zeigt sich wieder, dass der Mythos sowohl verlockend als auch gefährlich ist, da er die hässliche Wahrheit der Realität verschleiert. Hinzu kommt, dass die Konstruktionen idealer Schönheit die Grundlage der Schönheits- und Kosmetikindustrie bilden. Die Propagierung eines unerreichbaren Ideals ist das perfekte Mittel, um Menschen zum Kauf von Kosmetikprodukten und -verfahren zu bewegen.
Politische Konstrukte: "Billy Graham auf dem Vel d'Hiv"
Barthes beschreibt eine im Fernsehen übertragene Veranstaltung, bei der der amerikanische Evangelist Billy Graham 1955 im Pariser Stadion Vel d'Hiv predigte. Barthes betrachtet Graham als eine andere Version eines Hypnotiseurs oder Séance-Performers. Barthes geht sogar so weit zu behaupten, dass, "wenn Gott wirklich durch Dr. Grahams Mund spricht, man zugeben muss, dass Gott ziemlich dumm ist". Barthes zufolge ist es die Aufführung, nicht Grahams Botschaft, die die Menschen bewegt. Aber die subtile Botschaft ist da, und Barthes sagt, dass die Botschaft antikommunistische Propaganda ist.
Barthes behauptet, dass Grahams Besuch in Frankreich eindeutig durch die amerikanische Angst vor dem Atheismus und die vereinfachende Assoziation von Atheismus mit Kommunismus motiviert war. Barthes sagt, dass diese Art von Mythos Massen von Menschen dazu bringen kann, unlogisch zu denken und gefährlichen Suggestionen zum Opfer zu fallen, was möglicherweise katastrophale gesellschaftspolitische Folgen haben kann. Natürlich sind diese Folgen, die Barthes als katastrophal bezeichnen würde, genau das, was von den Schöpfern des Mythos - der mächtigen politischen Elite - beabsichtigt ist, da diese Art von Mythos wiederum dazu dient, die Machtstrukturen aufrechtzuerhalten.
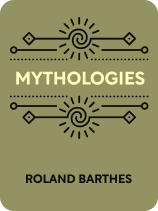
---Ende der Vorschau---
Gefällt Ihnen, was Sie gerade gelesen haben? Lesen Sie den Rest der weltbesten Buchzusammenfassung und Analyse von Roland Barthes' "Mythologies" bei Shortform.
Das finden Sie in unserer vollständigen Zusammenfassung von Mythologies:
- Die subtilen Botschaften, die unbewusst unser Weltbild prägen
- Wie Mythen genutzt werden, um kulturelle Normen und Werte zu festigen
- Warum Mythen eine Gefahr für die Gesellschaft darstellen können